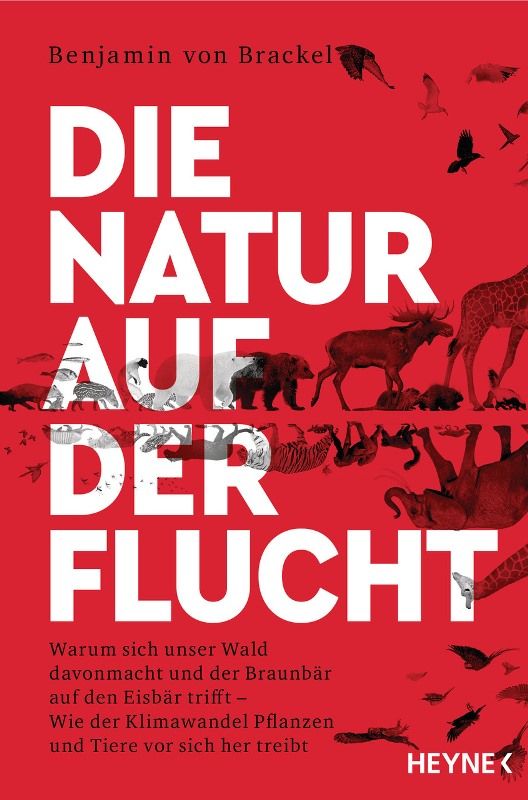Morgens um halb sechs liegt der Neue Fischereihafen von Cuxhaven noch im Dunkeln. Der Geruch von Fisch, Schiffsdiesel und Hafenwasser umweht die Auktions- und Verarbeitungshallen, die Kühlhäuser und Eiswerke.
Am Rand des Kais brennt im zweiten Stock eines Zweckbaus schon Licht. Dort sitzt an diesem 27. Januar 2020 Kai-Arne Schmidt in seinem Büro der Kutterfisch-Zentrale und kontrolliert die aktuellen Fischpreise – mal am Computer, mal am Telefon.
Seit 37 Jahren sorgt der Genossenschaftschef dafür, dass die Nord- und Ostseefischer Fangquoten und andere Vorgaben aus Brüssel und Berlin einhalten und den Fisch an Mann und Frau bringen. Unten in der Kühlhalle kippen seine Leute den Hol aus der Nordsee samt Eis auf den nassen Boden aus, hieven Seelachs und Kabeljau in Maschinen, welche ihrerseits Köpfe abschneiden, Rückgrat, Gräten und Haut abtrennen und das leuchtend weiße Fischfleisch teilen.
Männer und Frauen mit Mund- und Haarschutz kontrollieren an einem Förderband die Filets, ehe sie diese in Plastik einschweißen und mit einem Etikett mit QR-Code bekleben, der verrät, wo und wann die Fische gefangen wurden. Aus deutschen Gewässern jedenfalls kommen sie nicht mehr. Auch der Kabeljau nicht, den Schmidt nur "unser Sorgenkind" nennt.
Als er 1982 bei der Fischereigenossenschaft anheuerte, hing in Deutschland noch die Existenz Dutzender Familienbetriebe vom Kabeljau ab, die von Cuxhaven, Bremerhaven und Finkenwerder aus in der Deutschen Bucht fischten.
In den Städten zeugen bis heute Wandtafeln von der Bedeutung des Fisches mit dem vorstehenden Oberkiefer, den kräftigen Barteln und drei Rücken- und zwei Afterflossen, der so groß und schwer werden kann wie ein zehnjähriges Kind. "Damals haben wir allein vor Helgoland vier- bis sechstausend Tonnen Kabeljau in drei Monaten gefangen", schwärmt Schmidt. "Der Kabeljau war über Jahrzehnte unser Brotfisch."
Aus für kleine Fischereibetriebe
Zumindest bis zum Jahr 1993. Damals, erinnert sich der 55-Jährige, berichteten ihm seine Fischer, dass sie vor Helgoland keinerlei Kabeljau mehr in ihren Schleppnetzen fanden. Dafür aber einzelne Doraden oder Seeteufel, wie sie eigentlich nur im Mittelmeer vorkamen. "Leute, hier stimmt mir irgendetwas nicht!", entgegnete Schmidt.
Die Fischer standen vor einer schweren Entscheidung: Wer sich den Brotfisch weiterhin nicht entgehen lassen wollte, musste immer weiter auf die Nordsee hinaus. Allerdings konnten sich nur die wenigsten Familienbetriebe dieses Wettrennen leisten.
Denn nach Norden fallen die Gewässer ab: Vor Helgoland reicht die Nordsee gerade mal 50 Meter tief, in der Norwegischen Rinne aber bis zu 725 Meter. Dort braucht es Heckfänger, die für die raue Hochsee taugen. Die kleinen Betriebe aber konnten keine Millionen Mark für die schwimmenden Fischfabriken schultern. Und gingen pleite.
Von den deutschen Hochseefischern blieb im Grunde nur noch die Kutterfisch-Zentrale übrig. Ihre zehn Großkutter fangen in der Nordsee vor allem Seelachs – und als Beifang Kabeljau.
Nur noch die "Viktoria" fischt im Sommer gezielt nach dem Raubfisch. Noch in der Nordsee, der Norwegischen See und rund um die Shetlandinseln nehmen die Fischer den Kabeljau per Schlachtermesser aus und legen ihn an Bord auf Eis. 2.000 Tonnen pro Jahr, ein Bruchteil früherer Fänge.
In Hanstholm im Nordwesten Dänemarks löschen sie die Ladung, verladen sie auf Kühllaster und fahren sie nach Cuxhaven, wo sie die Filets bearbeiten und abermals auf die Reise schicken, ehe sie in Restaurants oder in Supermärkten in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien landen.
400 Kilometer nach Norden abgewandert
Seit Anfang der 1980er Jahre hat sich die Nordsee im Schnitt um 1,7 Grad Celsius erwärmt. Und das wirkt sich auf eine Fischart wie den Kabeljau aus, der in der südlichen Nordsee schon seit Jahrzehnten am oberen Temperaturlimit operiert: Er wandert ab in nördlichere und tiefere Gewässer.
Und dabei ist er nicht alleine. Bis zu 400 Kilometer haben Fischarten ihr Verteilungszentrum nach Norden verschoben. Und im Schnitt um 3,6 Meter pro Jahrzehnt in die Tiefe, wie Daten aus einer Grundschleppnetzfischerei-Untersuchung belegen.
Nichtsdestotrotz hat sich in der Nordsee die Zahl der Arten stark erhöht – dank der Einwanderer aus dem Süden. Forscher sprechen von einer "Subtropikalisierung" der Nordsee. Dominierten einst Kaltwasser-Arten wie Hering, Sprotte oder Kabeljau, übernehmen nun zunehmend wärmeliebende Arten das Ruder.
Buch
Von Benjamin von Brackel erschien im April bei Heyne das Buch "Die Natur auf der Flucht. Warum sich unser Wald davonmacht und der Braunbär auf den Eisbären trifft. Wie der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt".
Wie Streifenbarbe und Anchovis: Waren die beiden Arten Mitte der 1980er Jahre noch so gut wie gar nicht in der Nordsee zu finden, bevölkern sie inzwischen einen erheblichen Teil der Meeresfläche.
Auch Deutschlands Fischer sind verblüfft, weil sie immer öfter Thunfische oder Sardinen in ihren Netzen finden. Sie bringen diese Fische aus dem Süden auch auf den Markt, schließlich ist es seit ein paar Jahren verboten, Beifang über Bord zu werfen.
Allerdings sind die Einwanderer bislang nur ein Trostpflaster für den Verlust der größeren und oft profitableren Kaltwasserfische. Einige britische Fischereien haben sich aber schon komplett auf neue Fischarten wie Seebrassen oder Rotbarben umgestellt.
Kabeljau nah an der kritischen Schwelle
Besonders stark sind die Veränderungen beim Kalmar: Anfang der 1950er Jahre fand sich in den Netzen noch kein einziges Exemplar der Art. Inzwischen fangen die Fischer in manchen Jahren über 3.000 Tonnen in der gesamten Nordsee. Auch Schmidts Leute kommen regelmäßig mit Hunderten Kilogramm von ihren Ausfahrten zurück.
Kalmare gehören zu den Gewinnern des Klimawandels: Weil sich die Nordsee erwärmt, können sie schneller wachsen und erreichen früher eine Größe, die sie vor Raubfischen wie dem Kabeljau schützt. Dank der günstigen Bedingungen drehen sie den Spieß sogar um – und machen sich über jungen Kabeljau her.
Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven haben untersucht, was passiert, wenn sich die Meere vor der Haustür Europas weiter aufheizen und versauern. Sie haben Kabeljau aus der südlichen Barentssee geangelt und ins Labor nach Tromsø in Nordnorwegen verfrachtet. Dort setzten sie die Fische unterschiedlich hohen Kohlendioxidkonzentrationen und Temperaturen aus, je nach den Klimaszenarien für das Jahr 2100.
Das Ergebnis: Schaffen wir es nicht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, überschreiten wir die kritische Schwelle für die derzeitigen Laichgründe.
Ein ungezügelter CO2-Ausstoß würde es dem Kabeljau sogar ganz unmöglich machen, am Ende des Jahrhunderts noch südlich des Polarkreises zu laichen – also südlich von Lofoten. Heute bedeutende Fischgründe wie vor den Küsten Islands und Norwegens dürften dann verloren gehen. "Die Erhitzung kann das Zünglein an der Waage sein, das darüber entscheidet, ob der Organismus über die Klippe geht oder nicht", sagt der Meeresphysiologe Felix Mark vom AWI.
Langfristig könnte womöglich sogar Südeuropa stärker profitieren, weil die dort heimischen Warmwasserfische besser an den Klimawandel angepasst sind und zusätzliche Einwanderer aus den Tropen einströmen.
Es folgt Teil 3: Tiere und Pflanzen als Klimaschützer
Alle bereits erschienenen Teile unserer Serie zu den Wechselwirkungen von Klima- und Biodiversitätskrise finden Sie hier.