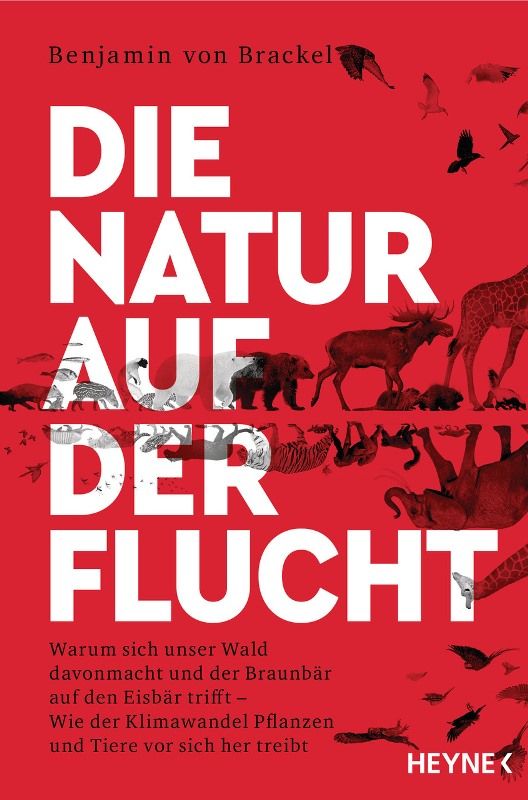Sie haben die gleiche Mutter, doch im Laufe ihrer fast 29 Lebensjahre haben die Schwestern höchst ungleiche Behandlung erfahren: Die eine wurde massiv bevorzugt, die andere mehr oder weniger ignoriert.
Auf dem historischen UN-Umweltgipfel in Rio im Mai 1992 haben die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nicht nur die Klimarahmenkonvention verabschiedet, die seither die Grundlage für den internationalen Klimaschutz bildet. Beschlossen wurde auch eine Konvention, die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist: das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, englisch kurz CBD.
Damals war noch nicht klar, wie eng beide Sphären miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen, weshalb sich beide Konventionen erstmal unabhängig voneinander entwickelten.
Während die jährlichen Klimagipfel trotz einiger Rückschläge immer stärker an Gewicht gewannen und 2015 ihren Höhepunkt im Pariser Klimaabkommen fanden, einem Vertrag mit einem ausgeklügelten Mechanismus, der die ganze Welt zum Klimaschutz verpflichtet, fristen die Kollegen auf den Biodiversitätsgipfeln bis heute eher ein Nischendasein. Ihre Versuche, sich der erfolgreicheren Schwester zu nähern und Gehör zu finden, verliefen all die Jahre genauso im Sande wie der Versuch, ein ähnlich ambitioniertes Rahmenwerk wie den Pariser Klimavertrag auch für den Artenschutz zu erkämpfen.
Der Botaniker und Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Universität Wien glaubt, dass das an der Komplexität des Artenschutzes liegt. Biodiversität umschließe Gene, Arten und Lebensräume und sei kaum einheitlich zu quantifizieren.
Die Logik der Klimagipfel zeichne sich hingegen durch das "Denken in universellen Einheiten" aus. Also CO2-Äquivalente. So schwer sich die Welt auch tut, weniger Kohlendioxid, Methan und andere Klimagase auszustoßen, so "einfach" lässt sich die Politik danach ausrichten. Dazu braucht man nur den CO2-Filter an alle politischen Maßnahmen anzulegen.
Wälder, Feuchtgebiete und Mangroven
Das neue Rahmenwerk, das in Kunming geplant ist (siehe Teil 1), soll nun auch dem Artenschutz den Stellenwert geben, den er nicht nur aus Sicht der Naturschützer verdient.
Zum einen mit einem griffigen Ziel, genau genommen einer Zahl: 30 Prozent. 30 Prozent der Landoberfläche der Erde sollen 2030 unter Schutz stehen. Derzeit sind es rund 17 Prozent und damit die Größenordnung der sogenannten Aichi-Ziele, die im Jahr 2010 auf dem zehnten UN-Biodiversitätsgipfel im japanischen Nagoya beschlossen wurden, darunter auch die Beseitigung von Subventionen, die der biologischen Vielfalt schaden, oder Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion.
Zum anderen wird immer klarer, wie groß die Synergien zwischen Klimaschutz und Artenschutz sind. Um etwa die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, reicht es nicht mehr "nur", sich von fossilen Energien zu lösen und weltweit auf erneuerbare Energien zu setzen. Auch auf die Ökosysteme kommt es an: Allein die Landökosysteme speichern rund ein Viertel der Treibhausgase, die der Mensch Jahr für Jahr ausstößt.
Die größte Rolle spielen dabei Wälder, vor allem die großen borealen Wälder in Nordamerika und Sibirien sowie die Regenwälder in Brasilien und Zentralafrika. 15 Prozent der Treibhausgase, welche die Welt in einem Jahr ausstößt, stammen aus natürlichen Habitaten – mehr als die Hälfte davon zuletzt von Brandrodungen in zwei Regionen in Indonesien und Brasilien.
Aber auch Feuchtgebiete und Mangroven gelten als Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Feuchtgebiete bedecken rund sechs bis neun Prozent der Erdoberfläche und enthalten über ein Drittel des globalen terrestrischen Kohlenstoffs. "Wir brauchen eine bessere Verknüpfung von beiden Themen, weil sie sich gegenseitig beeinflussen", fordert Florian Titze vom WWF.
Mit Weidetieren wird Grasland zur CO2-Senke
Allerdings – und das steht auf den UN-Klimagipfeln bisher nicht auf der Agenda – kommt es auch auf das an, was in den Wäldern, Steppen oder den Ozeanen lebt, wenn es darum geht, CO2 zu binden. Umweltwissenschaftler erkennen zunehmend die Bedeutung der Tiere für den Klimaschutz, egal ob diese in den borealen Nadelwäldern des hohen Nordens, den Tropenwäldern oder auch in den Savannen Afrikas leben.
Ohne die dort lebenden Tiere kann die Biosphäre ihre Fähigkeit verlieren, Kohlendioxid zu binden. Waldelefanten, Tapire, Vögel oder unterschiedlichste Säugetiere befördern etwa die Verteilung von Baumsamen. Wissenschaftler bezeichnen den Verlust der Tiere durch Wildtierjagd, Abholzung und Brände deshalb als "zusätzliche, stille Bedrohung" für unser Klima.
Buch
Von Benjamin von Brackel erschien im April bei Heyne das Buch "Die Natur auf der Flucht. Warum sich unser Wald davonmacht und der Braunbär auf den Eisbären trifft. Wie der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt".
Besonders eindrucksvoll ist die Fähigkeit der Tiere als Klimaschützer in der Serengeti zu beobachten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rafften Wilderei und Rinderpest dort drei Viertel der damals 1,2 Millionen Gnus dahin. Infolgedessen konnten die Gräser in die Höhe sprießen, bis die Trockenzeit kam und fast die gesamte Vegetation Jahr für Jahr abbrannte.
Nachdem 1963 die Rinder rund um den Nationalpark geimpft wurden, konnte sich der Gnu-Bestand in Tansania wieder erholen. Die Tiere knabberten die Gräser fleißig ab, verdauten sie und schieden die Pflanzenreste wieder aus. Spätestens nach dem nächsten Brand würde der gebundene Kohlenstoff aber wieder in die Luft freigesetzt – wäre da nicht der Mistkäfer, der den Dung zu Kügelchen rollt und zusammen mit seinen Eiern im Boden verbuddelt.
Weil die Gnus wiederum die Gräser abäsen, wachsen diese nicht mehr so hoch und fangen seltener Feuer. Deshalb verwandelte sich die Serengeti von einer CO2-Quelle in eine CO2-Senke. Wissenschaftler um Oswald Schmitz vom Institut für Wald- und Umweltstudien an der Yale-Universität in New Haven haben errechnet, dass diese Einsparung in etwa die gesamten jährlichen CO2-Emissionen Ostafrikas aufwiegt.
Klimaneutralitäts-Szenarien machen Ökologen nervös
Eric Dinerstein von der US-Denkfabrik Resolve sieht im Pariser Klimaabkommen deshalb nur "ein halbes Abkommen". "Es wird nicht allein die Vielfalt des Lebens auf der Erde retten oder Ökosystemleistungen erhalten, von denen die Menschheit abhängt", schrieb der Ökologe 2019 im Fachblatt Science Advances. "Es ist auch auf natürliche Klimalösungen angewiesen, die außerhalb des Paris-Abkommens gestärkt werden müssen."
Andersherum können Klimaschutzmaßnahmen dem Artenschutz auch schaden. So sieht der Weltklimarat in den meisten seiner Szenarien für das 1,5- oder Zwei-Grad-Ziel die massenhafte Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre vor.
Um etwa das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssten beispielsweise 18 Prozent der Landoberfläche mit Maisfeldern überzogen werden, damit die Pflanzen der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen. Nach ihrer Ernte werden sie verbrannt und damit Strom gewonnen, das entstandene CO2 wird unter die Erde gepresst, so die Theorie.
Nur wäre dann viel weniger Platz für den Nahrungsmittelanbau, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, geschweige denn für Tiere und Pflanzen.
"Als ich und meine Kollegen vom Weltbiodiversitätsrat erstmals gesehen haben, wie groß der Bedarf an potenziellem Biomasse-Anbau ist, sind wir ziemlich nervös geworden", sagt der Landschaftsökologe Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig.
Klimaschutz und Artenschutz gilt es deshalb auszutarieren. Eltern sollen ihre Kinder ja schließlich auch gleich wertschätzen.
Es folgt Teil 4: Die Finanziers des Artensterbens
Alle bereits erschienenen Teile unserer Serie zu den Wechselwirkungen von Klima- und Biodiversitätskrise finden Sie hier.