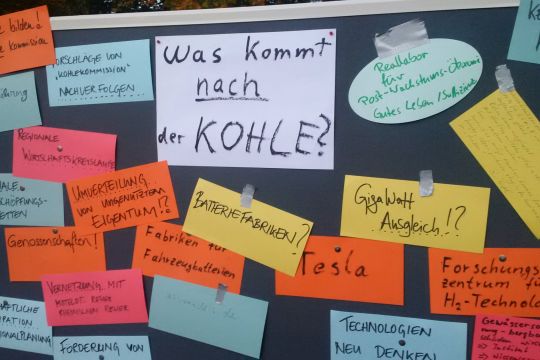Klimareporter°: Herr Holtemöller, die Braunkohle hat gesamtwirtschaftlich eine eher geringe Bedeutung für unser Land, verglichen etwa mit der Autoindustrie. Das bestätigt auch die Studie zu einem schnellen Braunkohle-Ausstieg aus Ihrem Haus. Warum in aller Welt wird daraus ein jahrelang umstrittener politischer Kraftakt?
Oliver Holtemöller: Der erste Punkt ist: Es gibt eine relativ große Konzentration der Betroffenheit. Die Standorte der Autoindustrie sind nicht nur auf viel mehr Regionen verteilt, sie stehen auch sonst so schlecht nicht da. In den drei verbliebenen Braunkohle-Regionen dagegen liegt die Arbeitslosigkeit schon jetzt – vor dem Ausstieg – über dem Bundesdurchschnitt.
Das Zweite ist: Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Es kommt nicht allein auf die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen an, sondern auch darauf, wie die einzelnen Menschen betroffen sind. Der Kohleausstieg beeinträchtigt ihre persönlichen Verdienstmöglichkeiten schon erheblich, ebenso die Region, in der sie leben.
Letztlich hat der Staat, wenn er so eine politische Entscheidung trifft, die Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und ihre Verluste ein Stück weit zu kompensieren.
Weil die Braunkohlebranche weit überdurchschnittliche Löhne und Gehälter zahlt, verlangt zum Beispiel in Brandenburg die Landespolitik zur Kompensation nicht einfach nur neue Jobs, sondern ähnlich gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Ist das realistisch?
Ich halte das für nicht realistisch. Dass die Industrie in Deutschland in den nächsten Jahren wachsen wird und es dort insgesamt zu einem Ausbau der Beschäftigung kommt – davon ist nicht auszugehen. Neue Industriearbeitsplätze in den Kohleregionen müssten insofern von woanders verlagert werden.
Wirklich neue Arbeitsplätze entstehen hierzulande – wie in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften auch – überwiegend im Dienstleistungsbereich, besonders im Gesundheitssektor. Aber es ist klar, dass Menschen, die 20 Jahre in der Braunkohle gearbeitet haben, nicht von heute auf morgen in so eine Dienstleistungstätigkeit wechseln können.
Dazu passt der berühmte Spruch des Vorsitzenden der Bergbaugewerkschaft IG BCE, Vassiliadis, der einmal sagte, die Lausitz könne nicht von Nagelstudios und Baumärkten leben.
Das würde ich nicht überbewerten. Herr Vassiliadis vertritt die Interessen einer Industriegewerkschaft. Das ist sein Job. Vor diesem Hintergrund kann ich diese Äußerung nachvollziehen.
Sicher – allein von Baumärkten und Nagelstudios kann man eine Region nicht ernähren. Die entscheidende Frage ist aber: Was sind realistische Alternativen dazu? Und die zentrale Schaffung neuer Industriearbeitsplätze in großem Umfang ist eben nicht realistisch. Das funktioniert aller Erfahrung nach nicht durch zentrale Planung.
Auch in einer Region wie der Lausitz werden qualifizierte Mitarbeiter schon jetzt händeringend gesucht. Dafür bewerben sich bloß eben keine Kohlearbeiter, weil sie sogar in diesen Industriejobs deutlich schlechter bezahlt werden. Um das Problem zu lösen, ist zum Beispiel im Gespräch, diesen Beschäftigten dann den Lohn aufzustocken.
Ich halte viel von solchen Vorschlägen, man muss aber die richtigen Anreize setzen. So sollte man zum Beispiel dem Ex-Kohlebeschäftigten nicht einfach versprechen, dass er dauerhaft soundso viel auf sein neues Gehalt dazubekommt, sondern sich intelligentere Lösungen einfallen lassen. Wir dürfen auch nicht nur auf ein einziges Instrument setzen, sondern brauchen einen ganzen Werkzeugkasten.

Zur Person
Oliver Holtemöller ist Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Universität Halle-Wittenberg, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und Leiter der dortigen Abteilung Makroökonomik. Zuvor lehrte und forschte er in Berlin, Gießen und Aachen.
Die Menschen sind unterschiedlich. Junge und gut qualifizierte Beschäftigte aus der Braunkohle werden wahrscheinlich relativ schnell einen Arbeitsplatz in einer anderen Region finden. Sie werden entweder abwandern oder pendeln. Das ist aus ökonomischer Sicht auch sinnvoll. Es wird nicht gelingen, diese Menschen aufhalten zu wollen.
Die betroffenen Länder sehen das natürlich anders. Hier muss man schon fragen, was zu tun ist, um wirtschaftlich relativ schwache Regionen langfristig zu fördern. Aber auch da erscheint es sinnvoller, Menschen individuell zu fördern, besonders bei ihrer Qualifikation, aber auch bei der Mobilität.
Weniger ratsam ist es, Subventionen an Unternehmen zu geben. Das führt meist nur zu Mitnahmeeffekten oder zu Tätigkeiten, die ohne Subventionen gar nicht lohnend wären.
Studien über die Beschäftigten in der Braunkohle weisen auch darauf hin, dass deren soziale Mobilität geringer ist, sie also weniger bereit sind, Beschäftigung und Ort zu wechseln. Wie lässt sich das ändern?
Auch hier gibt es keine Lösung für alle gleichermaßen. Für einen Teil der Beschäftigten wird es, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, sehr unattraktiv sein, woanders hinzuziehen und eine neue Arbeit aufzunehmen. Wahrscheinlich sollte man die individuelle Unterstützung nach dem Alter staffeln: Je jünger die Betroffenen sind, desto eher kann man erwarten, dass sie sich umorientieren.
Was halten Sie davon, Braunkohle-Regionen zu Sonderwirtschaftszonen zu erklären?
Ganz unabhängig von der Braunkohle spricht sehr viel dafür, regionalen Gebietskörperschaften – seien es die Länder oder die Kommunen – mehr Möglichkeiten zu geben, die Steuern, die vor Ort zu bezahlen sind, zu beeinflussen. Die lokale Autonomie könnte in dieser Hinsicht gestärkt werden.
Vonseiten des Bundes könnte es auch einen Zuschuss geben, wenn zum Beispiel eine struktur- und finanzschwache Gemeinde sagt: Wir reduzieren jetzt lokal diese oder jene Steuern, um die Ansiedlung von Unternehmen zu erleichtern. Ich würde das jetzt nicht Sonderwirtschaftszone nennen, sondern intelligente Förderung von Einnahmen-Autonomie auf lokaler Ebene.
Natürlich geht es dabei nicht um einen ruinösen Steuerwettbewerb. Unternehmen entscheiden sich nach einem Bündel aus Steuern und Infrastruktur für einen Standort. Das Gesamtpaket muss stimmen.
Auch in Ihrer Studie fallen bei einem beschleunigten Braunkohle-Ausstieg bis 2035 Löhne und Gehälter in Milliardenhöhe weg. Sie beziffern den Verlust bis 2040 auf vier Milliarden Euro. Viele Beschäftigte gehen bei einem Kohleausstieg ja in den Ruhestand und haben dort Bezüge. Wo kommt dann dieses große Minus her?
Unsere Studie vergleicht ein Basisszenario mit dem eines beschleunigten Ausstiegs aus der Braunkohle bis 2035. Schon im Basisszenario tragen wir dem Rechnung, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft und dass die Beschäftigung in der Braunkohlewirtschaft ohnehin abnehmen wird ...
… weil die Kohleunternehmen – wie andere auch – rationalisieren und jährlich ein bis zwei Prozent der Belegschaft abbauen.
Genau. Diese Effekte sind bereits im Basisszenario enthalten. Kommt es nun zu einem beschleunigten Ausstieg, gehen jedoch mehr Arbeitsplätze verloren – und zwar nicht nur in den betroffenen Regionen selbst. Die größeren Jobverluste treten deutschlandweit sogar dadurch ein, dass mit einem Braunkohleausstieg der Strom teurer wird.
Das sehen Braunkohle-Länder und die konventionelle Energiebranche so, andere Studien, darunter von renommierten Forschungsinstituten, kommen zum Ergebnis, dass der Strompreis nur marginal steigt.
Das könnte in der Tat durch den technologischen Fortschritt so sein, nur lässt sich das schwer vorhersehen. Schreibt man die Produktivitätsentwicklung aus der Vergangenheit fort, dann kommt es nach unseren Berechnungen bei einem beschleunigten Braunkohle-Ausstieg zu einer Verknappung des Stromangebots. Das bedeutet höhere Kosten für Unternehmen und für private Haushalte. Diese Effekte sind nicht groß, aber sie sind da.
Richtig ist auch: Die Einkommensverluste entstehen nicht nur in den Braunkohleregionen. Die lokale Kaufkraft dort sinkt viel weniger, als die Lohnverluste betragen, unter anderem durch die sozialen Transfersysteme.
In Ihrer Studie datieren sie das Enddatum für die Braunkohle auf 2035. Halten Sie diese recht ehrgeizige Jahreszahl wirtschaftlich für verkraftbar?
Die Jahreszahl 2035 zu bewerten, da tue ich mich als Wirtschaftswissenschaftler schwer. Ich kann nur sagen: Die gesamtwirtschaftlichen Effekte eines beschleunigten Ausstiegs bis 2035 sind eher klein, und wenn das Klimaziel als wichtig angesehen wird, sind diese Effekte für Deutschland auch tragbar.
Unser Land wird wegen eines Ausstiegs bis 2035 in keine ökonomische Krise geraten und ist auch in der Lage, die Einkommensverluste der Betroffenen zu kompensieren.