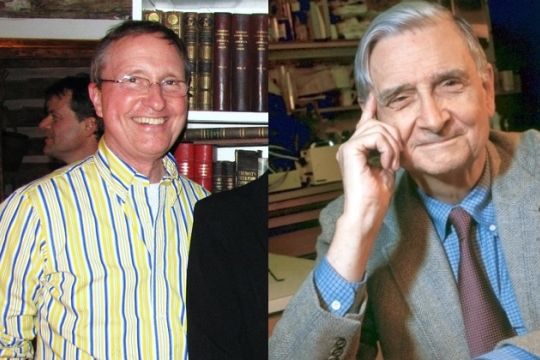"Wer vom Verlust nichts weiß, hat nichts verloren." (Publilius Syrus, etwa 100 v. Chr.)
Der Verlust der Biodiversität ist ein dramatisch unterschätztes Problem. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht und bräuchten umgehende Schutzmaßnahmen. Während die Menschen seit Jahrtausenden Einfluss auf die Umwelt nehmen, hat sich die Geschwindigkeit des Artensterbens in den letzten 200 Jahren infolge der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung dramatisch erhöht.
Gleiches gilt für die globale Klimakrise: Menschliches Handeln ist maßgeblich für die Klimaerhitzung in den letzten 200 Jahren verantwortlich, vor allem aufgrund von Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe sowie aus der Landwirtschaft und der veränderten Landnutzung.
Aber wie sehr sind wir uns unseres Einflusses bewusst? Um das volle Ausmaß der Zerstörung zu erkennen, ist eine langfristige Perspektive nötig. Einzelpersonen nehmen Veränderungen jedoch nur über relativ kurze Zeiträume wahr. Aufgrund fehlender Informationen oder Erfahrungen historischer Bedingungen akzeptiert jede Generation den Status quo, in dem sie aufgewachsen ist, als Normalzustand.
Mit abnehmender Biodiversität verschiebt sich der Referenzpunkt und wird zur neuen Baseline. Der Verlust von Arten oder Orten, die bei unserer Geburt bereits verschwunden waren, lässt sich nur schwer betrauern. Gleichzeitig nehmen große Teile der Gesellschaft das veränderte Klima – und beispielsweise vermehrt auftretende Wetterextreme – als normal wahr.
Verschiebung der Grundlinie
Dieser Wandel in der Wahrnehmung wird als Shifting-Baseline-Syndrom (SBS) bezeichnet: Langsame, aber stetige Umweltveränderungen können unbemerkt bleiben. Das SBS schafft eine neue akzeptierte Norm für den Zustand der Natur.
Dieses Phänomen erschwert die Umweltschutzbemühungen: Menschen werden zunehmend toleranter, wenn es um Umweltzerstörung geht, und haben einen veränderten Blick darauf, wie eine gesunde Umwelt und ein intaktes Klima aussehen.

Die Naturschutzbiologen Masashi Soga und Kevin Gaston haben einen Kontaktverlust und mangelnde Vertrautheit mit der Natur als Hauptgründe für das Shifting-Baseline-Syndrom identifiziert. Menschen verbringen mehr Zeit mit naturfernen Tätigkeiten oder haben keinen Zugang zur Natur. Darüber hinaus verschwindet Naturkunde aus dem Schulunterricht, besonders auf der Nordhalbkugel.
Das Shifting-Baseline-Syndrom lässt sich also auf soziale Praktiken wie Freizeitaktivitäten oder Bildung zurückführen. Im 19. Jahrhundert hat Karl Marx den Begriff Entfremdung geprägt. Nach Marx war die Entfremdung ein Ergebnis der Arbeit unter industrialisierten kapitalistischen Bedingungen.
Entfremdung beschreibt die fehlende Kontrolle der Arbeitskräfte über ihre soziale und natürliche Welt – unter anderem sind sie von ihrer menschlichen Natur entfremdet. Dabei ist Arbeit wohl die bedeutendste soziale Praxis im Leben eines Menschen.
Beschleunigen Arbeitsweisen den Trend?
Meine These: Entfremdete Arbeit und das Shifting-Baseline-Syndrom sind eng miteinander verknüpft. Arbeit im 21. Jahrhundert beschleunigt und verstärkt das SBS in drei Dimensionen. Nur wenn wir diese Dimensionen und ihre Folgen verstehen, können wir das Syndrom überwinden und den Verlust der Natur aufhalten.
Die erste, strukturelle Dimension der Arbeit befasst sich mit dem Wie und Was der Tätigkeit. Heute findet Arbeit, ob geistig oder körperlich, vor allem in der nördlichen und westlichen Hemisphäre überwiegend am Computer, an hoch technisierten Maschinen und sterilen Fertigungslinien statt.
Arbeitsabläufe sind völlig entkoppelt von biologischen Prozessen und der natürlichen Umwelt. Letztlich bedeutet dies, dass Menschen durch die Ausführung ihrer Arbeit den Kontakt zur Natur verlieren.
Die zweite, räumliche Dimension betrifft, wo wir arbeiten. Aus der ersten Dimension ergibt sich, dass der Großteil der industrialisierten und digitalisierten Arbeit in Büros, Industriegebäuden oder Produktionsanlagen verrichtet wird. Diese Arbeitsstätten befinden sich in Gewerbe-, Stadt- und Industriegebieten mit wenigen Naturräumen.
Die zunehmende Urbanisierung sowie das allgemeine globale Bevölkerungswachstum dürften diesen Trend weiter verstärken. Naturnahes Leben und Arbeiten und die Möglichkeit, die Natur regelmäßig zu erleben, werden immer seltener.
Die dritte, zeitliche Dimension befasst sich damit, wie viel wir arbeiten. Bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis arbeiten die Angestellten in der Regel etwa fünf Achtstundentage, gefolgt von einem zweitägigen arbeitsfreien Wochenende. In vielen Branchen werden bezahlte oder unbezahlte Überstunden erwartet und eine 60-Stunden-Woche ist keine Seltenheit.
Zudem folgt auf den bezahlten Vollzeitjob oftmals unbezahlte Arbeit in Form von Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen. Das Wochenende ist oft gefüllt mit anderen Aktivitäten wie Familienleben, Besorgungen oder Hobbys. So bleibt wenig Zeit, um die Natur zu erleben, etwas darüber zu lernen und vor allem Veränderungen zu bemerken. Für viele ist das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Privatleben und Natur gestört.
Wie können wir dieses Gleichgewicht wiederherstellen, um zur Natur zurückzufinden?
Gleichgewicht zwischen Arbeit, Privatleben und Natur finden
Eine Arbeitszeitverkürzung scheint von zentraler Bedeutung zu sein. Die zeitliche Dimension der Arbeit lässt sich am einfachsten ändern und kann die Auswirkungen der strukturellen und räumlichen Dimensionen abmildern. Eine Reduktion der Arbeitszeit würde zudem das Klima schonen.
Wir sind in der Tat eine der ersten Generationen, die in der Lage ist, dank Digitalisierung und Automatisierung ihre Arbeitszeit zu verkürzen und trotzdem ihren Lebensstandard beizubehalten. Die Vorteile daraus sollten für mehr Freizeit und Gleichberechtigung genutzt werden.
Iven Froese
ist Projektassistent im Bereich Biodiversität und Naturschutz beim Thinktank Adelphi in Berlin. Er arbeitet unter anderem zur Koexistenz von großen Beutegreifern und Menschen. Daneben ist er Student im interdisziplinären Masterprogramm "Integrated Natural Resource Management" an der Berliner Humboldt-Universität mit Fokus auf Mensch-Natur-Interaktionen und ökologische Ökonomie.
In Zeiten der Covid-19-Pandemie lässt sich ein starker Trend beobachten: Menschen verbringen mehr Zeit in der Natur. Mit verkürzten Arbeitszeiten könnten wir einen ähnlichen Effekt erwarten.
Menschen würden mehr Zeit in ihren Gemeinden und mit Freizeitaktivitäten verbringen. Viele dieser Aktivitäten finden in der Natur statt, wodurch der Kontakt zur und das Wissen um die Natur zunehmen und Menschen im Idealfall dazu inspiriert würden, sie zu schützen.
Letztlich ist der Wunsch nach mehr Zeit nicht neu. In den Worten des US-amerikanischen Dichters Walt Whitman: "Was ist dieses Leben, wenn wir nur an Sorgen kauen und keine Zeit bleibt, um zu stehen und zu schauen."
Wir müssen den Menschen die Zeit zurückgeben, die Welt um sich herum beobachten zu können, wenn wir sie dazu ermutigen wollen, wieder zur Natur zurückzufinden. Nur dann können wir als Gesellschaft die Verschiebung der Baselines erkennen und schließlich etwas unternehmen, um den Verlust der Natur aufzuhalten.
Weniger zu arbeiten bietet einen Ausweg aus dem Hamsterrad und ermöglicht eine Neustrukturierung des Verhältnisses zwischen Arbeit, Privatleben und Natur im 21. Jahrhundert.