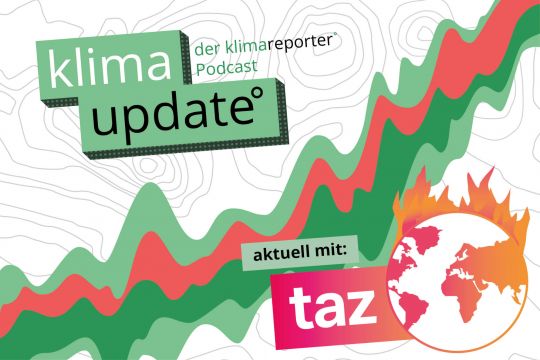Payal Parekh, 1973 in Indien geboren, untersuchte in ihrer Doktorarbeit die Rolle von Eisen im Meer zur Sequestrierung von CO2. Sie lebt heute in Bern in der Schweiz, ihre Arbeit ist weiterhin von globaler Bedeutung. Nur findet sie nicht mehr auf Fachtagungen statt, sondern im Hambacher Wald, auf der Straße – und überall dort, wo die Klimabewegung Druck macht auf die Politik. Sie erzählt mir davon, als sie von einer Wanderung in den Alpen zurückkommt:
Was braucht es im Jahr 2022? Ich denke: mehr Kooperation. Natürlich sind technische Erfindungen und Maßnahmen wichtig, aber wenn es keinen Willen in der Politik gibt, dann haben wir keine Chance angesichts der globalen Krisen.
Das hat man auch bei Corona gesehen: Nur wenn 90 Prozent der Weltbevölkerung einen Zugang zur Impfung hätten, gäbe es einen guten Schutz vor den Virusvarianten. Die Wissenschaft wusste das, aber die Politik hat nicht danach gehandelt.
Wenn wir aufgeben, kann sich nichts verändern. Wir können auch Krisen nutzen, um die Klimabewegung zu vergrößern, schließlich wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht.
Das habe ich 1990 gelernt, als ich für ein Jahr als Austauschschülerin nach Passau gekommen bin. Ein Schlüsselmoment für mein weiteres Leben als Aktivistin für soziale Gerechtigkeit war die Klassenfahrt nach Ostdeutschland. Ich bin zwar als Enkelkind eines Freedom Fighters in Indien aufgewachsen, aber die Geschichten über die Unabhängigkeitsbewegung vor 1947 waren weit weg – da war es etwas ganz anderes, von jemandem zu hören, der gerade das Ende der DDR miterlebt hatte.
Er sagte, noch sechs Monate vor der Wende hätte niemand in seinem Umfeld geglaubt, dass die Mauer fällt. Da habe ich verstanden: Wir wissen nie, wann es kippen kann. Diese Geschichte hat in mir viel bewegt: Was bedeutet das für den sozialen Wandel? Woher nehmen wir Hoffnung, wenn alles aussichtslos scheint?
Fakten und Theorien verstehen
Ich habe mich dann entschieden, Geologie zu studieren, ich erhoffte mir, hier Umweltthemen mit gesellschaftlichen verbinden zu können. Es war mein Vater, der mich überzeugte: Wenn man in diesem Feld etwas bewegen will, dann ist es wichtig, auch die naturwissenschaftlichen Fakten und Theorien zu verstehen.
Ich habe also studiert und war gleichzeitig in der Anti-Staudamm-Bewegung aktiv. In Indien gab es genug Beispiele, wo soziale Kämpfe rund um Ressourcen genau an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik ausgetragen wurden.
1997 bin ich einem Angebot gefolgt, in den USA meine Doktorarbeit in Meereschemie am MIT und am Woods Hole Oceanographic Institute zu schreiben. Ich hatte zwei, drei Jahre fast nichts verdient im Aktivismus in Indien. Außerdem wusste ich: Global gesehen wird das Klima noch wichtiger werden als die Staudämme. Wir waren wohl die erste Generation von Doktoranden, die ihr Thema ausgewählt haben, weil wir uns um die Zukunft Sorgen gemacht haben.
Mein späterer Chef ist schon damals oft in der Zeitung und im Fernsehen interviewt worden. Aber wenn er in der Öffentlichkeit über den Klimawandel gesprochen hat, gab es für ihn eine klare Grenze: Sobald gefragt wurde, welche politischen Maßnahmen es braucht, hat er aufgehört zu reden.
Das war 2006. Heute ist das anders, es hat sich wirklich vieles verändert nach Greta Thunberg. Jetzt redet auch er über Politik. Damals sagte er mir: "Payal, du bist eine sehr gute Forscherin, aber du bist zu politisch. Das wird schwierig."
Ich war Postdoktorandin und musste mich nach einer Stelle umsehen, und das ehrliche Gespräch mit ihm hat mir zu denken gegeben: Wenn mein Wille, etwas zu verändern, gelähmt wird, wenn es weniger Zugang zu Fördergeldern geben könnte, weil ich zu politisch bin, dann ist das nicht meine Welt. Ich habe auch gemerkt: Ich habe nicht mehr die Zeit und Energie, beides zu machen, politische Arbeit und Klimawissenschaft.
Höhepunkte, Tiefpunkte und Kipppunkte
Die Forschung hat mich nie sonderlich inspiriert, also schlug ich den anderen Weg ein. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke wie auf eine Wanderung, dann war auf jeden Fall die Zeit rund um das Paris-Abkommen von 2015 ein Gipfelpunkt.
Ich habe bei 350.org gearbeitet, als wir wirklich noch wie ein Start-up waren und den Spagat zwischen Graswurzelbewegung und NGO gut gemeistert haben. Es war die Zeit, in der Ende Gelände zum ersten Mal stattfand, und es hat sich toll angefühlt, etwas zu wagen, was mit Risiko verbunden war; ihnen Geld zu geben, ohne zu wissen, funktioniert das – funktioniert das nicht?
Ausgeforscht
Drei promovierte Klimawissenschaftler:innen erzählen, warum sie aus der Forschung ausgestiegen sind – und wie sie nun stattdessen mit der Klimakrise umgehen. Eine Kurzserie.
- Wir wissen doch schon alles!
- Geologin Payal Parekh: "Mein Chef sagte: 'Du bist zu politisch'"
- Mathematiker Wolfgang Knorr: "Wir Klimawissenschaftler haben die Menschheit im Stich gelassen"
- Physikerin Janina Messerschmidt: "Auf Konferenzen wurde in einem neutralen Ton vorgetragen, unglaublich"
Heute ist in gewissem Sinne auch die Wissenschaft Teil der Klimabewegung. Es gibt weiterhin das Credo in der Naturwissenschaft: "Wir wissen, worüber wir sprechen." Hinzugekommen ist: Wir wissen auch, dass es politische Maßnahmen braucht. No way, dass das jemand öffentlich gesagt hätte 2008, als ich die Universität verlassen habe.
Wenn Paris und die Zeit mit Fridays for Future Höhepunkte waren, dann ist die Zeit seit Corona definitiv ein dunkles Tal, ein Tiefpunkt. Ich sehe nicht wirklich Fortschritte, weder in der Bewegung noch in der Politik.
Aber da kommen wir wieder zu meiner ersten Geschichte: Wir wissen nicht, wann es kippt. 2022 könnte das Jahr sein, in dem wir die Klimabewegung wirklich verbreitern, damit sie mehr und mehr im Mainstream ankommt.
Aufgezeichnet von Theresa Leisgang